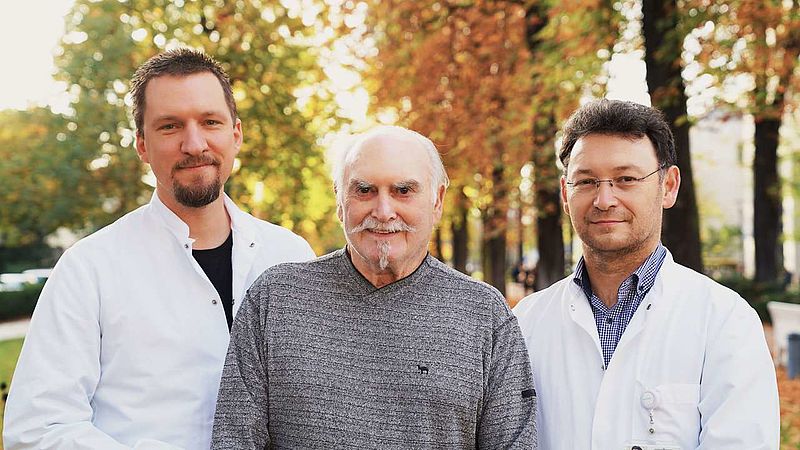Herzschwäche ist der häufigste Grund für Krankenhauseinweisungen und verursacht einen Großteil der Gesundheitsausgaben für Herz-Kreislauf-Erkrankungen in der westlichen Welt. Eine frühere Studie zeigte, dass die absolute Zahl der Krankenhauseinweisungen im Zusammenhang mit Herzschwäche in Deutschland zwischen 2000 und 2013 um 65 Prozent gestiegen ist.
„Vor der Wiedervereinigung im Jahr 1990 hatten Ost- und Westdeutschland nicht nur sehr unterschiedliche Sozial- und Wirtschaftssysteme, sondern auch unterschiedliche Gesundheitssysteme“, sagte Studienautor Professor Marcus Dörr von der Universitätsmedizin Greifswald.
„In Ostdeutschland wurde das System fast vollständig vom Staat betrieben (zum Beispiel arbeiteten weniger als ein Prozent der Ärzte in privaten Praxen) und es bestand ein erheblicher Mangel an technischen Geräten (zum Beispiel gab es ein Ultraschallgerät pro 32.000 Einwohner in Ostdeutschland im Vergleich zu einem pro 2.500 Einwohner in Westdeutschland)“, so Professor Dörr weiter. „Seit 1990 haben beide Regionen dasselbe föderale Gesundheitssystem mit mehr niedergelassenen Ärzten und ähnlichen klinischen Versorgungswegen.“
In dieser Studie wurde untersucht, inwiefern sich der Wechsel zu einem gemeinsamen System von 2000 bis 2017 auf die Anzahl und Dauer der Krankenhausaufenthalte und die Sterblichkeit im Krankenhaus aufgrund von Herzschwäche in West- und Ostdeutschland ausgewirkt hat. Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler prüften auch, ob, wie zuvor beschrieben, die Krankenhauseinweisungen wegen Herzschwäche weiter anstiegen und in beiden Teilen Deutschlands gleichermaßen auftraten. Die Daten stammen aus der Gesundheitsberichterstattung des Bundes, einer jährlichen Zählung stationärer Routinedaten.
Sie stellten fest, dass die absolute Zahl der Krankenhauseinweisungen aufgrund von Herzschwäche in ganz Deutschland weiterhin dramatisch zunahm, und dass es erhebliche Unterschiede zwischen den Regionen gab.
In den Jahren 2000 bis 2017 stieg die absolute Zahl der Krankenhauseinweisungen aufgrund von Herzschwäche in ganz Deutschland kontinuierlich um 93,9 Prozent (von 239.694 auf 464.724 Fälle). Dieser Anstieg war in Ostdeutschland deutlich stärker als in Westdeutschland (+ 118,5 Prozent vs. + 88,3 Prozent) und war in jedem der ostdeutschen Bundesländer höher als in jedem einzelnen westdeutschen Bundesland.
Die Zahl der Krankenhauseinweisungen für andere Diagnosen nahm im gleichen Zeitraum bundesweit nur leicht zu. 2017 war die Herzschwäche die Hauptursache für krankheitsbedingte Krankenhauseinweisungen in Deutschland, wiederum mit deutlichen Unterschieden zwischen Ost- und Westdeutschland (Anstieg von 1,5 Prozent auf 2,9 Prozent in Ost- gegenüber 1,4 Prozent auf 2,2 Prozent in Westdeutschland).
Während die Gesamtdauer der Krankenhausaufenthalte im Zeitverlauf kontinuierlich abnahm, stieg die Gesamtzahl der herzschwächebezogenen Krankenhaustage in Ost- und Westdeutschland um 50,6 Prozent bzw. um 34,6 Prozent an.
Im Jahr 2017 blieb die Herzschwäche mit einem Anteil von 8,2 Prozent an den Todesfällen im Krankenhaus mit Abstand die häufigste Todesursache in Deutschland. Auch hier waren die Raten der stationären Todesfälle in Ostdeutschland (64 bzw. 65 Todesfälle je 100.000 Einwohner in den Jahren 2000 und 2017; ein Anstieg um 1,6 Prozent) im Vergleich zu Westdeutschland (39 bzw. 43 Todesfälle je 100.000 Einwohner in den Jahren 2000 und 2017; ein Anstieg um 10,3 Prozent) deutlich höher.
Professor Dörr sagte: „Da Ost- und Westdeutschland mit unterschiedlichen Gesundheitssystemen begonnen haben, stellten wir die Hypothese auf, dass sich die Hospitalisierungsmuster bei Herzschwäche nach der Wiedervereinigung angleichen würden. Diese Hypothese musste verworfen werden, und in der Tat wurde das Gegenteil festgestellt.“
Er merkte an, dass sich die beobachteten Unterschiede nicht durch die unterschiedlichen Altersstrukturen in Ost und West erklären lassen. Das Durchschnittsalter der Bevölkerung in Ostdeutschland ist vier Jahre älter als in Westdeutschland, aber die Unterschiede in den herzschwächebezogenen Parametern waren nach der Standardisierung für das Alter und in den verschiedenen Altersgruppen ähnlich.
„Eine mögliche Erklärung für unsere Befunde könnte in der unterschiedlichen Prävalenz von Risikofaktoren liegen, die die Entstehung, das Fortschreiten und damit die Hospitalisierung der Herzschwäche beeinflussen“, sagte Professor Dörr. „Tatsächlich haben frühere Forschungen gezeigt, dass zum Beispiel Bluthochdruck, Diabetes, und Adipositas in Ostdeutschland viel häufiger vorkommen als in Westdeutschland.
„Darüber hinaus können Unterschiede in der Struktur der Patientenversorgung die Differenzen zumindest teilweise erklären“, fügte er hinzu. „Es ist davon auszugehen, dass in beiden Teilen Deutschlands noch nicht alle Strukturen und Wege des nationalen Gesundheitssystems vollständig übernommen wurden.“
Professor Dörr schloss: „Es bedarf weiterer Forschung, um die großen Unterschiede zwischen Ost- und Westdeutschland zu erklären. Darüber hinaus ist es von großem Interesse, herauszufinden, ob solche regionalen Unterschiede auch in anderen europäischen Ländern bestehen. Letztendlich sollte das Ziel darin bestehen, Lösungen zu entwickeln und umzusetzen, die die Versorgung bei Herzschwäche in ganz Europa verbessern, um diese verheerende und tödliche Krankheit einzudämmen.“
Kontakt: Prof. Marcus Dörr, Universitätsmedizin Greifswald, marcus.doerr(at)uni-greifswald.de
Quelle: Pressemitteilung der European Society of Cardiology
In Ostdeutschland sterben mehr Menschen an Herzschwäche als in Westdeutschland